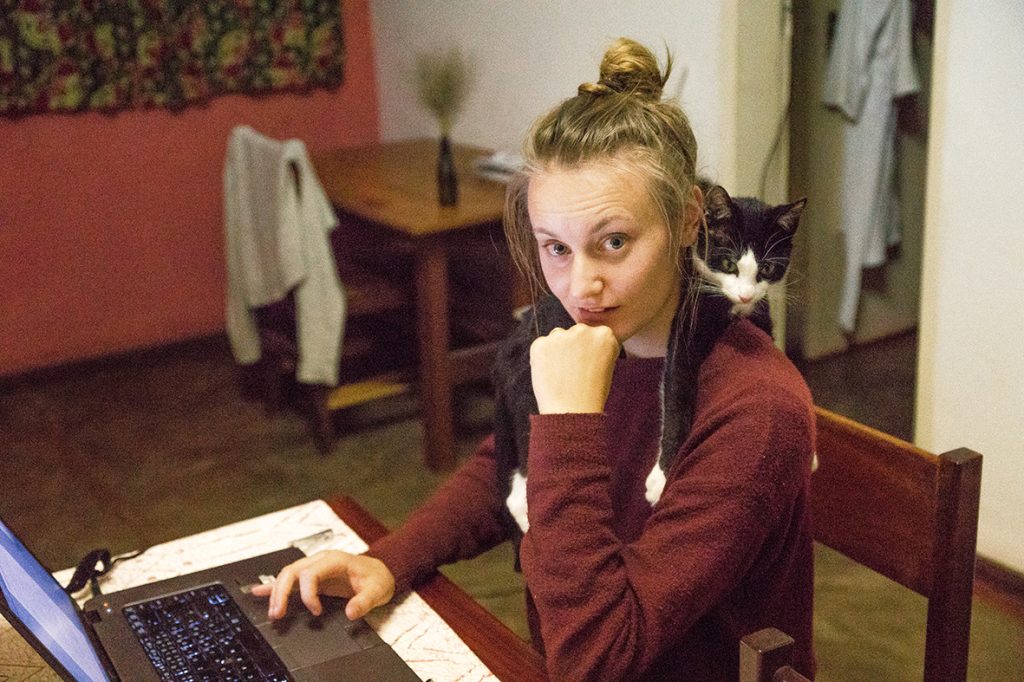Helene und Martin DANLER (AT)


Zambia,
Chikowa
Martin und Helene sind inzwischen wieder zurück in Österreich
Zwei spannende, herausfordernde, aber auch bereichernde Jahre liegen hinter ihnen. In ihrem letzten Missionsbericht schauen sie gemeinsam mit uns auf ihre Zeit in Sambia zurück:
„Liebe Freunde, liebe Familie,
voller einprägsamer Erinnerungen und Momente blicken wir ein wenig wehmütig auf die letzten zwei Jahre Mission in Sambia zurück. Heute in genau zwei Wochen sitzen wir bereits im Flugzeug nach Österreich. Es ist nicht leicht zu fassen, dass wir sehr bald wieder in der „Zivilisation“ unter Gleichgesinnten sein werden. Aber können wir wirklich Gleichgesinnte sagen? Naja, die Kultur und die Hautfarbe ist die gleiche, doch wie sehr haben die zwei Jahre Afrika unseren Blick und unsere Denkweise geprägt? Eine Kultur, in der Zusammenhalt innerhalb einer Familie und eines Stammes an erster Stelle steht und jeder, der nur im Entferntesten miteinander verwandt ist, zusammenhält: beim Pflanzen, Ernten, der Kindererziehung und Altersvorsorge. Auch finanziell unterstützen sie sich ohne Wenn und Aber. Alles gehört allen und keiner wird zurückgelassen. Eine Kultur, in der niemand gestresst durch das Leben geht, sondern jeder das Leben genießt. Bei uns lebt man das „Zeit ist Geld“ – hier leben sie mit dem Motto „pangono, pangono“ (langsam, langsam – mit der Zeit). Und diese Einstellung zieht sich durch ihr ganzes Leben. Die Menschen sind so glücklich und jeder überlebt, weil jeder zusammenhält und am gleichen Strang zieht. Es gibt keine Burnouts oder psychischen Probleme wegen Arbeitsüberforderungen… Das sind ein paar von ihren schönen Kultureigenschaften, die wir hier sehen und lernen durften, um nur ein paar Beispiele zu nennen… All diese Momente, Erfahrungen und Erlebnisse werden wir in unserem Herzen mitnehmen und versuchen, damit einen neuen Platz in unserer alten-neuen Heimat zu finden…
Anfängliche Herausforderungen – ein Blick an den Anfang
Ich kann mich noch gut an ein paar Erlebnisse am Anfang erinnern, bei denen wir nicht wussten, was wir antworten, tun oder wie wir am besten reagieren sollten. Einmal kamen wir in ein Dorf. Der Dorfhauptmann, seine Frau und ein paar andere Erwachsene aus dem Dorf empfingen uns vor ihrem Haus und boten uns an, uns doch bitte hinzusetzen. Es gab drei Stühle und eine Matte am Boden. Nun war die Preisfrage: welcher Platz war für uns, welcher für die Männer, die Frauen und welcher für den Hauptmann bestimmt? Englisch konnten sie nicht. Wir wollten beide bescheiden sein und setzten uns auf den Boden. Doch der Hauptmann gab Martin sehr deutlich zu verstehen, dass sein Platz neben ihm auf dem Stuhl war. Später kamen wir drauf, dass die Frauen üblicherweise am Boden sitzen und die Männer auf den Stühlen. Egal ob alt oder jung, Gast oder nicht. Ein anderes Erlebnis das Martin nicht so schnell vergessen wird, war ganz am Anfang, als er noch Unternehmertum am Fachkolleg unterrichtete. Gut vorbereitet gab Martin, so wie wir es in Europa mit praktischen Beispielen, einbinden der StudentInnen und gemeinsamen Diskussionen kennen, seine erste Unterrichtsstunde. Doch der Unterricht war ein Desaster. Alles was die StudentInnen wollten, war Frontalunterricht mit fix-fertig präsentierten Definitionen. Mit dieser Methode wurden sie nämlich von klein auf schon immer unterrichtet und mit allem anderen konnten sie überhaupt nichts anfangen.
Womit wir anfänglich auch große Schwierigkeiten hatten, war das Lesen ihrer Emotionen. Außer, wenn sie gerade ein Ereignis feiern, zeigen die Sambier kaum Emotionen. Eines Tages, als ich mit einem Arbeiter, der die Schule renovieren sollte, einen Tagelohn ausmachte und eine Geldsumme nannte, kam absolut keine Reaktion. Der Mann starrte mich einfach nur an. Ich war unheimlich irritiert und wusste nicht: hatte ich vielleicht einen unverschämt geringen Lohn für die Arbeit gefragt? Als der Mann nach einer gefühlten Minute „no problem“ sagte, war ich doch ein wenig erleichtert. Wäre es zu wenig gewesen, hätte er schließlich doch irgendetwas gesagt. Im Nachhinein kam ich darauf, dass ich ihm überdurchschnittlich viel geboten hatte. Inzwischen haben wir gelernt, die kaum vorhandenen und anfänglich nicht ersichtlichen Emotionen zu erkennen und zu deuten. Auch haben wir gelernt, uns ihrer Sprache anzupassen. Diejenigen, die Englisch sprechen, haben ein sehr einfaches Englisch. Ohne groß formulierte Sätze, nur mit einer einfachen Sprache, in der sie jedes überflüssige Wort einfach weglassen, kommen sie direkt auf den Punkt. Zum Beispiel kommt Esther (unsere Shopkeeperin) nachdem sie das Brot für den Shop gebacken hat zu mir, damit ich die Brote zähle und ruft mich mit einem kurz und knackigen: „Helen, you must come, count bread.“ (Helene, du musst kommen, zähle Brot). Auch das „Bitte“ lassen sie hier weg. Das existiert in ihrem Sprachgebrauch nicht. Dafür umso mehr das „Danke“ oder „Entschuldigung“. „Danke“ sagen sie dafür wirklich für alles. Manchmal ersetzten sie das „Bitte“ sogar damit. Schon oft ist es mir passiert, dass ich neben einem Einheimischen gehe, über etwas stolpere oder mich wo anstoße und sie neben mir „Sorry, sorry“ sagen. Das ist irgendwie voll nett.
Viel haben wir einfach mit der Zeit gelernt und uns langsam an ihre Kultur und Umgangsart angepasst und angenähert. Mein Bruder, der uns kürzlich besuchen kam, meinte zu mir, ich hätte ein schrecklich sambisches Englisch entwickelt. Dafür habe ich jetzt, im Gegensatz zum Anfang unserer Mission, zumindest mit den Einheimischen absolut keine Verständigungsprobleme mehr.
Afrika – eine Lebensschule
Auf uns mehr oder weniger alleine gestellt – in einer praktisch neuen Welt ohne Familie und Freunde um uns herum – mussten wir uns eine gegenseitige Stütze sein. Oft konnte uns, mit allem was wir gerade erlebten oder durchmachten, niemand ganz verstehen. Das brachte uns dazu, dass wir in unserer Beziehung noch richtig weiterwachsen konnten.
Auch lernten wir alles noch mehr wertzuschätzen. Wenn es mal für ein paar Tage kein fließendes Wasser im Haus mehr gab, dann wurde entweder einfach nicht geduscht oder man ging mit Flaschen oder Kübeln bepackt zum nächsten Bohrloch um Wasser zu pumpen. Oder es gab ein spontanes Candle-Light-Dinner, wenn es wieder einmal einen Stromausfall gab. Der Strom wird in Sambia nämlich durch einen Staudamm erzeugt. Damit der Wasserspeicher nicht zu schnell aufgebraucht wird, müssen sie immer wieder die Stromversorgung unterbrechen.
Was sich bei uns am meisten geändert hat, ist definitiv unser Weltbild und unser Blick auf Afrika. Vor unserer Ankunft in Sambia wussten wir nur wenig über Afrika im Allgemeinen. Man sieht die Bilder und Aufnahmen aus Nachrichten und Dokumentationen und bekommt ein Bild geprägt von Armut und Lehmhütten mit Strohdächern. Mit Sambia selbst gab es für uns noch keine Berührungspunkte und so hatten wir auch noch keine Vorstellung was uns erwartete. Als wir das erste Mal in Lusaka, der Hauptstadt Sambias ankamen, wurden wir begrüßt von viel Straßenverkehr, Staub und geschäftigem
Treiben entlang der Straßen. Gefühlt hätten wir uns auch in Süditalien befinden können. An der Hauptstraße in der Hauptstadt kam man an Hochhäusern, Hotels, Einkaufszentren und Golfplätzen vorbei. Mit dem Einfluss der westlichen Länder entsteht ein Lebensstil, den sich nur die allerwenigsten leisten können. Umso krasser war der Kontrast, als man an ärmere Viertel vorbeikam. Es gibt eine riesengroße Kluft zwischen reich und arm. Doch was bedeutet es „arm“ zu sein? Sich kein Mobiltelefon leisten zu können, kein Dach über dem Kopf zu haben oder Hunger zu leiden? Während unserer Zeit in Chikowa lernten wir eine neue Perspektive kennen: die Menschen sind nicht so arm wie man auf den ersten Blick meint und sie sind viel fortgeschrittener, als wir mit unserem anfänglichen Afrikabild angenommen hatten.
Am Anfang wirkten die Ziegelhäuser mit Wellblechdächern in Chikowa ärmlich, doch heute würden wir sagen: „Wow, die haben sich einiges geleistet!“. Man findet immer noch Lehmhütten mit Strohdächern hier und da, doch die Mehrheit baut ihr Eigenheim aus selbstgebrannten Ziegeln, denn das bedeutet Fortschritt und Entwicklung. Ziegelhäuser sind beständiger und Wellblech verrottet nicht, so wie das Stroh, das nach jeder Regensaison gewechselt werden muss. Wer in gute Materialien investiert, hat später weniger Arbeit. Auch im Busch ist der Westen angekommen: Die Leute in Chikowa laufen mit Tastenhandys und Smartphones herum und am Markt dröhnt der neueste Pop-song aus Amerika aus den Lautsprechern. Ich musste zweimal hinschauen, als ich die erste Strohhütte mit Satellitenschüssel und Solarpanels am Dach sah. Genauso war ich überrascht, als meine Tischler über das letzte Fußballmatch in der Europa-Meisterschaft diskutierten oder mir Mr. Zimba von den aktuellen starken Überschwemmungen in Europa erzählte, die er in den BBC-News gesehen hatte und mich sogar fragte, ob meine Familie auch davon betroffen war. Ein anderes Mal erzählte ich einem Kunden, dass ich aus Österreich bin und seine Reaktion war: „Oh! Österreich! Dann kennst du sicher Patson Daka! Ein Fußballspieler aus Sambia, er spielt bei FC Redbull Salzburg!“ Ich hab‘ nur genickt und war so überrascht, dass ich gar nicht antworten konnte.
Der erste Eindruck von Chikowa wirkte arm, doch sobald man die Leute näher kennenlernte, bekam man ein neues Bild. Diejenigen die einen Job hatten und ein regelmäßiges Einkommen, konnten sich ein gewisses Maß an „Luxus“ leisten und das präsentieren sie auch sehr gerne. Wir waren zu Besuch bei einem der Tischler und saßen zusammen im kleinen Wohnzimmer. Das Haus war für unsere Verhältnisse recht klein, gebaut aus unverputzten Ziegeln, mit gestampftem Lehmboden, doch schaffte Lufeyo seine sechs-köpfige Familie und sein ganzes Hab & Gut hier unterzubringen. In einem Vitrinen-Schrank waren schöne Teller und Töpfe präsentiert, in der Ecke stand ein kleiner Röhrenfernseher und ganz stolz zeigte er uns seine Stereoanlage, durch die er uns ein sambisches Lied vorspielte. Wir aßen zusammen Nshima und Fisch, das uns seine Frau zubereitet hatte. Er bot uns Limonade an und seine Kinder lugten aus dem Nebenzimmer unter den Tüchern hervor, mit denen der Blick in die anliegenden Räume verhüllt war. Nach näherem Kennenlernen mussten wir feststellen, dass seine Familie alles hatte, was sie benötigten um zu leben: ein Haus über dem Kopf, genügend zu essen, Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung. Natürlich nicht mit dem Standard in Europa zu vergleichen, aber genug um zu leben. Aus ihrer Perspektive würden sie sich niemals als arm bezeichnen. In anderen Familien hat der Vater oder die Mutter vielleicht keine Anstellung, doch trotzdem überleben sie. In diesem Fall hilft die ganze Familie zusammen und sie leben von dem, was sie anbauen. Wenn die Ernte gut ausfällt, dann kann eine Familie gut davon leben, das Problem ist nur, wenn durch äußere Umwelteinflüsse die Ernte nicht für das gesamte Jahr ausreicht, dann heißt es hungern oder als Tagelöhner anderweitig Geld verdienen.
Durch diesen ländlichen Kontext und die Abhängigkeit der Menschen von gutem Wetter für die Ernte, bekommt man auch beim Lesen der Bibel eine neue Perspektive. Wenn man in der Sonntagsmesse die Lesung hört und sie spricht vom Aussäen der Saat, das Bitten um guten Regen und Hoffen auf reichen Ertrag, bekommt die Bibelstelle in solch einem Umfeld ein ganz anderes Gewicht. Man erlebt hier die Bibel so ursprünglich und fundamental. Im Vergleich zu Sambia leben wir in Europa inzwischen weit entfernt von dieser Realität. Sambia und die Menschen hier kennenzulernen war ein absolutes Privileg für uns.
Wir sind total dankbar, dass Helenes Bruder und seine Freundin uns schlussendlich kurz vor unserer Abreise doch in Sambia besuchen konnten. Das gab uns noch einmal die Gelegenheit durch Sambia zu reisen und zum Schluss einen noch weiteren Blick von Sambia zu bekommen. Außerdem war es sehr schön unsere Lebensumstände und Erfahrungen zu zeigen und auf diese Weise auch zu teilen. Das hat uns definitiv auch sehr geholfen alles noch einmal zu reflektieren und aus anderen, frischen Augen zu sehen.
Unsere ersten Adoptionen – ans Herz gewachsene Erinnerungen
Ein ganz ein besonderer Moment in unserer Mission war, als wir eine Baby Eule vor unseren Katzen retteten und sie kurzzeitig adoptierten. Eines Tages saßen wir vor unserem Haus und genossen noch die letzten Sonnenstrahlen als wir etwas im Gebüsch hüpfen und rascheln hörten. Unsere Katze wurde davon auch ganz hellhörig und wollte sich schon anschleichen. Gerade rechtzeitig erkannten wir zum Glück, dass es eine Baby Eule war. Sie war ganz zutraulich und ließ sich sofort von uns nehmen. Irgendwie war sie aus dem Nest gefallen, konnte aber noch nicht fliegen. Weil wir nicht wussten, wo ihr Nest war, nahmen wir sie für die Nacht in unsere Veranda auf und gaben ihr frisches Fleisch. Sie war noch sehr klein und ganz flauschig, sie hatte noch kein echtes Gefieder entwickelt. In der Nacht kamen ihre Eltern neben unsere Veranda und starrten sie durch das Moskitonetz an. Aber außer ein paar leiser Laute und ein wenig Gehüpfe war sie ganz ruhig. Am nächsten Tag, als es dann hell war, gingen wir auf Nestsuche. Sogar unsere sambischen Nachbarn halfen uns bei der Suche. Schlussendlich setzten wir sie am Abend an einem hören Ast auf einem Baum ab, wo wir wussten, dass es verschiedene Nester gab. Wenn sie wollte, konnte sie so von Ast zu Ast hüpfend, wieder in ihr Nest zurückkehren. Am darauffolgenden Morgen war sie nicht mehr da.
Was richtig schwer sein wird, ist der Abschied von unseren Katzen, die uns richtig ans Herz gewachsen sind. Als wir im September 2019 in Chikowa ankamen adoptierten wir 2 Babykatzen, Simba und Charly, von den Comboni Missionaren. Ihre Katzen hatten nämlich wieder mal ordentlich für Nachwuchs gesorgt. Charly bekam ein Jahr später zwei Jungs, Bärli und Balu und unsere Familie wurde somit immer größer. Wir sind zwar sehr traurig sie zu verabschieden, aber wir sind guter Dinge, dass unsere Nachfolger unsere gutmütigen Katzen mit viel Liebe und vielen Streicheleinheiten verwöhnen werden.
Tischlerei – eine Erfahrung für das Leben
Meine letzten Tage in der Tischlerei waren geprägt von Vorbereitungen und dem Fertigstellen von Projekten. Einerseits musste ich meine Tischler so weit einweisen, dass sie auch ohne mich die Arbeiten fertigstellen konnten und andererseits hatte ich einige Dokumente und Informationen für meinen Nachfolger Andrew aus Amerika vorzubereiten, damit er gut ausgerüstet Anfang September in seine Mission als neuer Tischlerei-Manager starten kann.
Unglaublich dankbar kann ich auf eine wertvolle Zeit zurückblicken, in der ich mich sowohl in meiner Persönlichkeit als auch fachlich in großen Schritten weiterentwickeln konnte. Zu Beginn war es nicht immer leicht, denn als ich meine Mission begann, war die Tischlerei bereits zum zweiten Jahr in Folge im Minus. Es stand die Frage im Raum, ob es nicht besser wäre, die Werkstatt zu schließen. Unter diesem Druck konzentrierte ich mich darauf, die Tischlerei wieder auf die Beine zu stellen und schaffte es durch personelle Umstrukturierungen und Ressourcenoptimierungen im ersten Jahr bereits Profit zu erwirtschaften. Am Ende meiner Mission gelang es mir sogar den Gewinn zu verdreifachen, auf das ich wirklich sehr glücklich bin! Durch die Covid-Situation war es wirklich dringend notwendig, da zu dieser Zeit sogar die Landwirtschaft nur sehr geringe Einnahmen generieren konnte und die Gelder für die Unterstützung und Erhaltung der Fachschule benötigt wurden. Durch die Einnahmen der Tischlerei konnte das Projekt somit über Wasser gehalten werden.
In solch einem Kontext einen Betrieb zu leiten, gab mir die einmalige Möglichkeit verschiedenste Arbeitsbereiche kennenzulernen. Anfangs war ich mir gar nicht sicher, ob das Organisieren und Managen meine Leidenschaft war, doch musste ich mit der Zeit feststellen, dass es mir sehr viel Spaß machte. Vor allem mitzuerleben, wie mein ganzer organisatorischer Aufwand und meine Leitung zusammenspielten und meine Zeichnungen und Pläne schlussendlich zur Realität wurden. Jetzt freue ich mich darauf im Oktober mein Masterstudium weiterzuführen und mit all den Erfahrungen und neuen Ideen motiviert wieder in mein Studium einzusteigen.
Übergabe der Vorschule an die Einheimischen – letzte Volontärin
Wenn man sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit macht, dann baut man ein Projekt mit dem Ziel auf, dann wenn es “Reif” ist, an die Einheimischen zu übergeben. Nach fast 10 Jahren und der gesammelten Arbeit von 6 Fidesco Volontären in der Vorschule, war das Projekt in meiner Missionszeit dann langsam so Reif, dass man die Leitung an die Einheimischen übergeben konnte. So durfte ich im letzten halben Jahr, den vom Staat angestellten Direktor darauf vorbereiten und einstimmen die Vorschule mehr und mehr in die Eigenverantwortung zu nehmen. Wie bereits beschrieben sind die Vor- und Volksschule halb kirchlich und halb staatlich und wurden durch die Comboni Missionare aufgebaut. Die Volksschule hat somit einen vom Staat angestellten und bezahlten Direktor der offiziell auch für die Vorschule zuständig ist. Einen Volontär können die Comboni Missionare wiederum als Administrator der z.B. Vorschule nach Belieben einsetzten, da sie eben auch halb-kirchlich ist. So war es überhaupt möglich die Vorschule, mithilfe von all den Volontären, auf so einen guten Stand zu bringen.
Es war sehr schön zu beobachten, dass kein Volontär mehr notwendig ist und die Vorschule jetzt nur mehr durch ihre Hände geleitet werden kann. Auch, wenn Father Luigi immer noch jederzeit ein Machtwort sprechen könnte, liegt die Schule jetzt in ihrer Verantwortung. Und daraus können sie nur wachsen.
Ein neuer Lebensabschnitt
Nun sind wir nicht nur am Ende dieses letzten Berichtes angekommen, sondern auch ans Ende unserer Mission. Es wird richtig komisch sein, nicht mehr vom Gegacker der Hühner und Hähne geweckt zu werden, dafür von Autos und Flugzeugen, die wiederrum hier im Busch eine große Rarität darstellen. Auch wird es komisch sein, diesen besonderen, sehr frischen Geruch von nasser Erde der Regenzeit nicht mehr zu riechen. Das werden wir schon sehr vermissen.
Wir werden beide in Innsbruck zusammenziehen, wo Martin sein Masterstudium in Architektur wiederaufnehmen wird. Voraussichtlich fehlt ihm nur noch ein gutes Jahr bis zum Abschluss. Ich wiederum werde an der FH Gesundheit in Innsbruck als Medien- und Videodesignerin beginnen. Mal sehen was die Zukunft bringt!
Danke!
Und uns bleibt jetzt nur noch ein riesiges Dankeschön auszusprechen. Danke, dass Du einen Teil unseres Weges mit uns mitgegangen bist und durch uns so in Sambia mitgewirkt hast! Danke für jeden der uns im Gebet begleitet hat! Danke für jede Nachricht und jede Bestärkung, die wir in dieser Zeit bekommen haben! Einfach ein riesengroßes Dankeschön!
Wir wünschen alles Liebe und viel Segen!
Helene & Martin
Copyright für alle Bilder Helene Danler
Martin und Helene beginnen ihr gemeinsames Eheleben mit einer Mission.
Beide kommen aus Tirol und waren ganz offen, sich überall hin schicken zu lassen, da wo sie gebraucht werden. Ihr Missionsland ist Sambia.
- Martin ist Architekt und wird in Sambia am Chikowa Youth Development Centre im Bereich Möbel und Inneneinrichtung kreativ mitwirken. Mit den Einnahmen des Centre soll der Kindergarten in der Mission Chikowa unterstützt werden.
- Helene ist Fotografin und wird vor allem im Kindergarten tätig sein. Wir freuen uns schon sehr auf Fotos von ihr.
In Chikowa ist ein kleines Team von Fidesco-Freiwilligen an verschiedenen Projekten beteiligt: dem Chikowa Youth Developement Centre CYDC, dem Saint Daniel Kindergarten, der landwirtschaftlichen Produktion und den Missionsprojekten der Comboni Brüder.
Einen Eindruck von der Mission finden Sie im Video:
 Sie wollen selbst Volontär werden? Wie das geht finden Sie hier …
Sie wollen selbst Volontär werden? Wie das geht finden Sie hier …
Sie wollen unsere Volontäre unterstützen? Dann klicken Sie bitte hier …
"Fidesco kann jeder. Von Single, Paar, frisch verheiratet, Pensionist - wirklich jeder!"